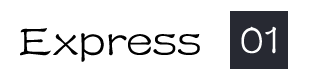Fast unbemerkt hat der Gesamtbeitragssatz zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung die einst als „rote Linie“ deklarierte Grenze von 40 Prozent in den letzten zwei Jahren passiert und liegt heute schon bei 42 Prozent. Ohne Reformen wird dieser Satz bis 2050 auf über 50 Prozent steigen. Verantwortlich dafür ist vor allem der demografische Wandel – und ein Sozialstaat, der zu viel verspricht, aber zu wenig vorsorgt.
Besonders akut ist die Lage in der sozialen Pflegeversicherung. In keiner anderen Säule der Sozialversicherung schlägt der demografische Wandel so stark durch: Immer mehr Menschen werden pflegebedürftig, immer weniger zahlen ein.
Schon heute reichen die laufenden Einnahmen kaum aus, um die zugesagten Leistungen zu finanzieren. Und dennoch wird das Leistungsversprechen in der Politik weiter ausgedehnt, als gäbe es kein Morgen. Wer ständig neue Leistungen fordert, lenkt von den eigentlichen Herausforderungen ab: Fachkräftemangel, fehlende Digitalisierung, mangelnde Koordination der Akteure.

Christian Hagist ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar.

Stefan Fetzer ist Professor für Public Health und Internationale Gesundheitssysteme an der Hochschule Aalen.
Es braucht zuerst ein solides Fundament
Wir müssen daher die Krise nutzen, um Pflege neu zu denken. Innovation entsteht dort, wo kluge Regeln und verlässliche Finanzierung zusammenkommen. Der aktuelle Flickenteppich aus politisch motivierten Leistungsversprechen verhindert echte Strukturreformen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Deshalb brauchen wir jetzt ein Leistungsmoratorium. Es darf keine neuen oder ausgeweiteten Leistungen in der sozialen Pflegeversicherung mehr geben – nicht aus Hartherzigkeit, sondern aus Vernunft. Wer weiter auf einem wackeligen Fundament aufbaut, riskiert den Einsturz des ganzen Gebäudes.
Ein Moratorium schafft Stabilität. Diese ist unerlässlich, will man in Pflegeeinrichtungen investieren oder Pflegepersonal ausbilden. Bei gleichzeitiger Preisanpassung bestehender Leistungen ermöglicht ein Moratorium Planungssicherheit – und damit die Chance, Qualität und Effizienz systematisch zu verbessern. Mit einem Moratorium schaffen wir Raum für neue Konzepte – etwa in der ambulanten Versorgung, durch digitale Unterstützung oder erweiterte Kompetenzen für Pflegekräfte.
Der Pflegevorsorgefonds benötigt mehr Mittel – und dieses Geld muss klüger und länger angelegt werden.
Doch ein Moratorium allein reicht nicht. Die soziale Pflegeversicherung (SPV) leidet an einem Konstruktionsfehler. Bei ihrer Einführung 1995 war der demografische Wandel längst bekannt – und trotzdem wurde sie fast ausschließlich umlagefinanziert.
Die heutigen Beiträge werden direkt für heutige Leistungsfälle ausgegeben. Nur ein kleiner Teil der Beiträge fließt seit einigen Jahren in den sogenannten Pflegevorsorgefonds, der Kapital für die Zukunft aufbauen soll. Doch dieser Fonds ist viel zu klein, zu kurz gedacht und mit einem viel zu konservativen Anlageprofil konzipiert.
Expertentipps für die Koalitionsverhandlungen
Dies ist der zweite unserer Gastbeiträge zum Thema Finanzierung der Gesundheit und Pflege, die vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD zur Bildung einer neuen Bundesregierung erscheinen. Den ersten Teil mit Empfehlungen für eine Reform der Krankenversicherung lesen Sie hier.
Der Fonds benötigt mehr Mittel – und dieses Geld muss klüger und länger angelegt werden. Derzeit darf der Pflegevorsorgefonds maximal 20 Prozent seines Kapitals in Aktien investieren. Damit bleibt ihm die Chance auf auskömmliche Renditen, wie sie andere Länder längst erzielen, verwehrt.
Norwegen oder Schweden machen es vor: Ein öffentlicher Fonds sollte langfristig orientiert, breit gestreut und professionell gemanagt werden. Mit einer Zielrendite von sechs Prozent könnte der Fonds künftig spürbar zur Beitragsstabilisierung beitragen – gerade, wenn die Babyboomer pflegebedürftig werden.
Derzeit ist geplant, ab 2035 auf die Reserven des Fonds zurückzugreifen. Die Babyboomer kommen erst rund zehn Jahre später in ein pflegeintensives Alter. Die gute Nachricht lautet daher: Wir hätten eigentlich mehr Zeit, um Kapital anzusparen.
Aber auch mit einer solchen Verzögerung gilt: Das Anlagevolumen von jährlich 0,1 Beitragssatzpunkten ist viel zu klein und muss auf mindestens einen Beitragssatzpunkt ausgebaut werden. Ja, das bedeutet zunächst höhere Zuführungen – also mehr Beiträge heute. Aber das ist generationengerecht. Nur wenn wir – insbesondere die Babyboomer – heute vorsorgen, schützen wir die Jüngeren vor übermäßigen Lasten morgen.
Wer kann, muss sich an den Kosten beteiligen
Gleichzeitig müssen wir offen und ehrlich darüber sprechen, was viele in der politischen Debatte vermeiden: Pflege wird nie kostenlos sein. Sie muss es auch nicht. Aber sie kann und darf keine Vollkaskoversicherung werden.
Eine solidarische Teilkaskoversicherung wie die soziale Pflegeversicherung ist sinnvoll: Sie schützt vor ruinösen Kosten und verteilt das Risiko auf viele Schultern. Wer heute in die Pflegeversicherung einzahlt, ist morgen vielleicht selbst betroffen. Wer eigene Mittel hat – etwa ein abbezahltes Eigenheim oder nennenswerte Ersparnisse –, muss sich im Pflegefall daran beteiligen. Alles andere wäre zutiefst unfair.
Es ist nicht unzumutbar, im Pflegefall auch eigenes Vermögen einzubringen, es ist Ausdruck von Fairness und Augenhöhe.
Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, zahlen unsere Kinder und Enkel für unsere Ansprüche mit hohen Beiträgen und der dadurch sinkenden Lebensqualität, weil ihnen nach Abzug von Sozialabgaben und Steuern kaum noch etwas bleibt.
Das ist nicht solidarisch, sondern kurzsichtig. Generationengerechtigkeit bedeutet auch, Eigenverantwortung zu leben. Es ist nicht unzumutbar, im Pflegefall auch eigenes Vermögen einzubringen, es ist Ausdruck von Fairness und Augenhöhe.
Die soziale Marktwirtschaft lebt vom Prinzip der Leistung und der Verantwortung – auch in der Pflege. Wer kann, hilft. Wer nicht kann, wird unterstützt. Schon heute greift in Fällen von Bedürftigkeit die Sozialhilfe. Niemand wird im Pflegefall alleingelassen. Aber um das Niveau dieser Unterstützung zu sichern, dürfen wir das System nicht mit pauschalen Leistungsversprechen überfordern.
Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag in der Pflege. Einen, der auf Stabilität, Kapitaldeckung und Eigenverantwortung setzt. Der Beitragssatz darf nicht weiter aus dem Ruder laufen – sonst ziehen die Jungen Konsequenzen: Sie wandern aus, weichen in die Schwarzarbeit oder Teilzeitarbeit aus. Dann kippt nicht nur die Pflegeversicherung – dann kippt das Vertrauen in den Sozialstaat insgesamt.
Unsere Vorschläge zeigen: Es gibt einen Weg aus der Krise. Aber wir müssen ihn gehen. Jetzt. Ein Leistungsmoratorium, ein gestärkter Pflegevorsorgefonds mit klugen Anlagerichtlinien und eine klare Regelung zur Heranziehung von Vermögen im Pflegefall: Das sind keine Zumutungen, sondern Maßnahmen für einen langfristig stabilen Beitragssatz in der Pflegeversicherung.
Dieser muss zwar kurzfristig um einen Prozentpunkt angehoben werden, ermöglicht dafür aber langfristig stabile Beiträge und damit ein verlässliches System. Das ist verantwortungsvolle Sozialpolitik. Generationengerecht. Realistisch. Und dringend notwendig.