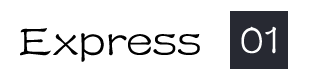Am 23. Juli 1992 lief Sudbin, ein Teenager, mit seinem jüngeren Bruder am Flussufer entlang. Es war Krieg in Bosnien, serbische Milizen wollten das Land „ethnisch säubern“. Nichtserben wurden verfolgt, vertrieben, getötet. Die beiden Jugendlichen waren in Gefahr, als sie einem Serben begegneten. Er war ein Kollege ihres Vaters gewesen und erkannte die Jungen. „Kehrt sofort um!“ rief er, drängte sie zu einer Kolonne von Bussen am Straßenrand, und schärfte ihnen ein, sie sollten in den letzten Bus einsteigen. So rettete er ihnen das Leben.
Das Buch
Taina Tervonen: Die Reparatur der Lebenden. Zwei Frauen in Bosnien-Herzegowina auf der Suche nach den Ermordeten des Krieges. Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky. Zsolnay Verlag, Wien 2025. 208 Seiten, 25 €.
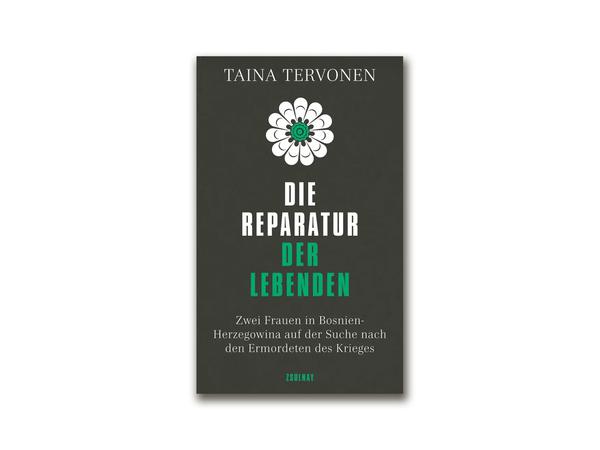
© Zsolnay Verlag
Die anderen Busse fuhren direkt in das Lager Keraterm, wo Männer und Jungen erschossen und in Massengräbern der Region verscharrt wurden. Dort wären auch Sudbin und sein Bruder geendet. Am Massengrab von Tomašica, das etwa 400 Tote barg, beginnt die dokumentarische Erzählung der Reporterin Taina Tervonen. Ab 2010 war sie über Jahre oft in Bosnien und Herzegowina unterwegs, interviewte für einen Dokumentarfilm Überlebende wie Sudbin und Angehörige von Toten, schrieb auf, was sie erfuhr, und begleitete die Arbeit derer, die den Lebenden die Toten zurückgeben. Daher der Titel ihres eindrucksvollen Buches „Die Reparatur der Lebenden“.
Reparatur ist eine bescheidene, wenngleich treffende Bezeichnung für das Unterfangen, um das es Tervonen geht. Der Krieg, getrieben von serbischem Nationalwahn, vorbereitet durch massenhafte Gerüchte und Denunziationen in Radio, Zeitungen und Fernsehen, hatte die Sehnen und Nerven der Zivilisation zerschnitten.
Menschen wurden zusammengetrieben, verschleppt und summarisch erschossen, ganze Familien wurden ausgerottet. Vor allem die Männer und Jungen hat man ermordet, um die Rückkehr von Überlebenden zu verhindern, die in traditionell patriarchalen Familien auf männlichen Schutz vertrauten.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Tervonen, 1973 in Finnland geboren, aufgewachsen im frankophonen Afrika, lebt in Paris, wo sie während der Pandemie ihr Buch schrieb. In Bosnien hat sie zwei Frauen begleitet, die aktiv an der Bewältigung des Krieges arbeiten, der Überwältigung durch den Krieg ihr Wissen und Können entgegensetzen. Sie sind die Protagonistinnen der Erzählung. Senem ordnet menschliche Überreste aus Massengräbern den Namen der Toten zu. Darija spricht mit Angehörigen, die DNA-Proben abgeben, um die Verwandtschaft mit den Exhumierten zu ermitteln. Im Stil der Reportage und mit literarischen Passagen, die nie gesucht wirken, eröffnet die Autorin ein Panorama der Rezivilisierung nach dem Krieg. Die Gewalt geschah mit großer Geschwindigkeit. Abtransport wehrloser Leute, Salven aus Maschinengewehren, Verscharren der Ermordeten – all das brauchte nicht lange. Die zivilisierte Aufarbeitung dauert Jahre, schließlich Generationen. 110 000 Opfer hatte der Bosnienkrieg, 30 000 Menschen wurden vermisst. Tausende fand man inzwischen in den etwa 70 Massengräbern Bosniens.
Daran beteiligt, ans Licht zu bringen, was unter der Erde verschüttet werden sollte, sind Dutzende von Professionen. Dazu zählen forensische Anthropologen, forensische Mediziner und Kriminalisten, Baggerfahrer, Bauarbeiter, Archäologen, Leichnamreiniger, DNA-Analysten, Morgue-Verwalter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte.
Während der Exhumierungen kommen täglich Angehörige, die ihre Toten finden wollen. Sie bringen den Grabungsteams Essen mit. Sie erzählen von den Verschollenen, weinen, erinnern und hoffen. Zu erfahren, wo ihre Brüder, Väter, Männer waren, wo sie heute sind, ist für die Psyche der Angehörigen essentiell. Erst dann können sie Abschied nehmen.
Der Unterschied zwischen Grausamkeit und Zivilisation ist auch der zwischen Verscharren und Bestatten, zwischen einem Massengrab und einer individuellen Grabstätte. Doch nicht alles lässt sich aufklären. Serbische Täter ließen einige der Primärgräber wieder aufreißen, um die Opfer noch besser zu verstecken, in entlegeneren Sekundärgräbern. Manchmal finden sich so die Überreste ein und desselben Menschen in zwei Gräbern.
Die Arbeit mit den Lebenden, sagt Senem, die Forensikerin, sei schwerer, belastender. „Case Manager“ betreuen die Familien, deren DNA den Abgleich mit den Exhumierten erlaubt, einige finden Therapeuten oder wenigstens psychologischen Rat. Oft dauert es Jahre des Wartens, bis Vermisste exhumiert und identifiziert wurden. Manche werden wohl nie gefunden.
Die Serbin Darija, Tervonens zweite Protagonistin, sammelt bei Familien Blutproben zum DNA-Abgleich und Informationen über die Vermissten. Sie bekommt Fotoalben gezeigt, sie hört Geschichten aus den Familien. Wie die Mitarbeiter der Grabungsstätten ist Darija, einst Kunststudentin, angestellt bei der International Commission on Missing Persons, der ICMP, die 1996 auf Initiative von Bill Clinton entstand. Feindseligkeit von Muslimen erlebe sie nie, berichtet Darija. Die Bevölkerung versteht, worum es bei Arbeit wie der ihren geht.
Taina Tervonen gelingt es, eins der schwersten Themen so klug anzugehen, dass Interesse geweckt und nicht von der Schwere erdrückt wird, woran auch die vorzügliche Übersetzung mitwirkt. Zugleich taucht am Horizont der Lektüre die Ahnung von der Arbeit auf, die andere Regionen in und nach Krieg und Bürgerkrieg, etwa die Ukraine, vor allem aber Syrien, noch vor sich haben.