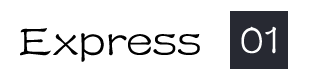Es ist jedes Jahr wieder ein 1-A-Aufreger. Wenn die Kulturverwaltung die Statistik der Besucherzahlen veröffentlicht und all jenen, die sich ein Leben ohne Theater, Oper und Sinfoniekonzert vorstellen können, das Frühstücksbrötchen aus dem Mund fällt.
Nicht wegen der 3.270.233 Zuschauerinnen und Zuschauer, die im vergangenen Jahr zu den Aufführungen der hauptstädtischen Bühnen strömten – wie viele Fußballfans waren 2025 eigentlich live in den Stadien der Berliner Mannschaften? Sondern wegen der „Subventionen pro Platz“: 260 Euro in der Staatsoper! 219,30 Euro bei der Deutschen Oper! 213 Euro beim Deutschen Theater! 192,40 Euro bei der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz!
Diese Rechnung ist in der Tat dazu angetan, die Gemüter zu erregen. Andererseits: Einfach die Summe der investierten Staatsknete durch die Menge der verkauften Tickets zu teilen, das wird der Komplexität der Arbeitsbedingungen im Kulturbereich nicht gerecht – und erinnert ein wenig an Äpfel-und-Birnen-Vergleiche à la Donald Trump.
Kultur ist hochqualifizierte Handarbeit
Theater, Oper und Sinfoniekonzert sind nun einmal keine normalen Wirtschaftsbetriebe, bei denen man mit Rationalisierung und Technisierung endlos die Effektivität steigern kann. Dort, wo abends Künstler auf der Bühne stehen, geht es nur mit der traditionellen Manufaktum-Methode. Will sagen: Damit eine Aufführung zustande kommt, müssen sehr viele hochqualifizierte Menschen hochgradig spezialisierte Handarbeit leisten. Bei Live-Veranstaltungen benötigt man zwingend Darsteller, Technik, Maske, Beleuchtung, Souffleuse, Inspizient, und, und, und. Bei Opern kommen sogar noch Chor und Orchester dazu.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Selbstverständlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die Welt auch ohne diesen Luxus so schlecht bleibt, wie sie ist.
Gleichzeitig waren die Kulturinstitutionen auch in allen früheren Spar-Runden stets bereit, ihren Beitrag zu leisten. Und sind es jetzt wieder. Was lautstarken Protest gegen eine Politik nicht ausschließt, die in der Kürzungsdebatte bislang ebenso plan- wie kopflos agiert.
Nur wenige Megastars kassieren groß ab
Eine goldene Nase verdienen sich übrigens in der Kultur nur wenige Megastars – und auch deren Einkommen bewegt sich meilenweit unter dem von Bundesliga-Kickern. Die allermeisten, die ihr Leben der Bühne weihen, werden eher bescheiden bezahlt. Was die hohen Kosten verursacht, ist, wie gesagt, die Vielzahl von Fachleuten, die für jede Aufführung gebraucht werden.
Was also tun? Zunächst muss die Politik Verantwortung übernehmen. Der Regierende Bürgermeister und sein Kultursenator sollten klipp und klar sagen, wie viel Kultur sie für finanzierbar halten. Berlins Ruf in der Welt, seine Attraktivität für Touristen wie Zugezogene, ist erwiesenermaßen an die Vielfalt des kulturellen Angebots gekoppelt. Durch die Schließung von Bühnen oder auch Museen würde dieses Renommee leiden. Doch wenn so ein Schritt zur Haushaltskonsolidierung nötig ist, muss der Senat das entscheiden und dann dazu stehen.
Im Gegenzug könnten die Kulturinstitutionen ihre Etats transparent machen – damit jede und jeder sehen kann, wohin welcher Euro fließt, der dann abends symbolisch als dicker Geldschein-Packen auf jedem Zuschauersessel liegt. Und ja, die Intendantinnen und Intendanten sollten proaktiv erklären, wie und wo sie ganz konkret bei ihren Ausgaben sparen wollen. Denn sie tun es ja bereits.

Frederik Hanssen Geboren 1969 in Berlin, Studium der Musikwissenschaften in Berlin, Mailand und Clermont-Ferrand. Musikkritiker seit 30 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert Klassik-Redakteur im Tagesspiegel-Feuilleton.
Menschen, die stets mit dem eigenen Auto fahren, zahlen nolens volens auch für die BVG-Subventionen, und umgekehrt. Kinderlose finanzieren das Schulsystem mit, Zeitgenossen, die ihren Abfall nicht einfach auf die Straße werfen, müssen dennoch für die Entsorgung des Mülls der anderen berappen. Und Opernfans, die sich nicht die Bohne für Fußball interessieren, müssen dennoch zusehen, wie ihre Steuergelder dafür draufgehen, dass Hunderte von Polizeibeamten bei sogenannten Risikospielen dafür sorgen, dass die Fans der gegnerischen Mannschaften sich nicht die Köpfe einschlagen. So funktioniert nun einmal eine pluralistische Gesellschaft.
Lesermeinungen zum Artikel
„Zur Wahrheit gehört auch, dass man wohl nirgendwo ein homogeneres Publikum finden wird als in der Oper: fortgeschrittenes Alter, akademisch, besserverdienend, ohne Migrationshintergrund. Dass ausgerechnet diese Gruppe für ihr Privatvergnügen derart hoch subventioniert werden muss, erschließt sich mir nicht.“ Diskutieren Sie mit Community-Mitglied Machtsjutnachbarn