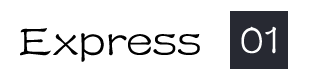Erst nach dem Tod seiner Mutter erfährt Alex Jaromin (dargestellt vom 34-jährigen Österreicher Noah Saavedra), dass er zwanzig Jahre unter dem falschen Namen Patrick Schneider im Zeugenschutz gelebt hat. Und auch, dass sein Vater Frank kein Gebirgsjäger war, sondern ein Geheimagent mit der Lizenz zum Töten, erfährt er erst zwei Jahrzehnte nachdem sein Vater und seine kleine Schwester vor seinen Augen im Jahr 2003 erschossen wurden.
Die sechsteilige ARD-Serie „Das zweite Attentat“ (Folgen 1-3 am 9.4., die Episoden 4-6 am 11.4., jeweils um 20.15 Uhr im Ersten, sowie alle Folgen bereits jetzt in der ARD-Mediathek) begibt sich mit dem jungen Mann, der in Athen als Fotograf arbeitet, auf die atemlose und zugleich lebensgefährliche Suche nach der Wahrheit hinter seinem eigenen Leben und den Todesumständen seines Vaters.
Dabei wird er mehr Geheimnisse aufdecken, als ihm – vor allem aber jenen Strippenzieher hinter den Kulissen von Politik, Geheimdiensten und Militär – recht ist. Denn jenseits von allen Lügen und Scharaden wird an ein unrühmliches Kapitel globaler Machtspiele erinnert, das in einen Krieg der Vereinigten Staaten und der Allianz der Willigen gegen den Irak mündete. Ein Krieg, an dem Deutschland zwar nicht teilgenommen hat, aber an dessen Zustandekommen die Bundesrepublik (Stichwort Curveball) einen gewichtigen Anteil hatte.
Hinter der Serie, die von Regisseurin Barbara Eder spektakulär in Szene gesetzt wurde und in der Schauspieler wie unter anderem Désirée Nosbusch, Jakob Diehl und Deleila Piasko glänzen, steht der Schriftsteller Oliver Bottini (59). Für ihn war die Produktion zugleich ein wichtiger Schritt hin zum Drehbuchautor, berichtet er im Interview.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Herr Bottini, ein Informant des deutschen Geheimdienstes mit dem Codenamen „Curveball“ als Schlüsselfigur beim Irakkrieg von 2003: Wie kommt es, dass diese Steilvorlage für einen deutschen James-Bond-Thriller erst jetzt als TV-Serie verfilmt wurde?
Das habe ich auch nicht verstanden. Da haben wir diesen Wahnsinnsstoff mit einem deutschen Informanten und einem deutschen Geheimdienst in einem globalen Konflikt – und keiner schreibt darüber? Das fand ich schon sehr merkwürdig, dachte aber: umso besser für mich.
Dreh- und Angelpunkt der gemeinsamen Geschichte von Roman und Serie ist ein Scharfschützeneinsatz des BND im Irak. Gibt es vergleichbare Einsätze wirklich?
Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob es beim BND Präzisionsschützen gibt. Aber sicher ist, dass der BND mehrere Hundert Mitarbeiter hat, die der Bundeswehr angehören. Und dass der BND vor Auslandseinsätzen der Bundeswehr vor Ort die Sicherheit überprüft. Dabei muss der BND seine Teams absichern. Wie kann man das besser machen als durch Präzisionsschützen? Zudem weiß man seit Längerem, dass der BND 2003 zwei Agenten in Bagdad hatte. Diese blieben auch im Krieg dort und klärten auch für die Amerikaner auf. Die Figur von Alexs Vater Frank Jaromin ist allerdings meine Erfindung.
BND, Kanzleramt, US-Geheimdienste und amerikanisches Militär: Welche Grenzen gibt es dabei für die schriftstellerische und filmische Freiheit?
Ich versuche immer, mit realen Settings zu arbeiten. Nach diesen Vorbildern erfinde ich meine Geschichten und Figuren. So wie die fiktive „Gruppe Schmidt“ innerhalb des BND oder das Annandale-Institut in den USA, das als Vorbild den neo-konservativen US-Think-Tank „Project for the New American Century“ hat. Schon in den 1990ern wollte es den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton zum gewaltsamen Regime-Change im Irak drängen. Diese Interessensgruppen ziehen im Hintergrund die Strippen und sind einflussreicher und mächtiger als wir es uns vorstellen können.
Alles richtig gemacht oder komplettes Desaster – wie würden Sie die Rolle Deutschlands auf dem Weg zum Irakkrieg bewerten?
Das ist schwer zu beantworten. Die Warnungen an die Amerikaner, dass dieser BND-Informant möglicherweise unzuverlässig ist, dass er trinkt, sich teilweise widerspricht und mitunter nicht auffindbar ist, die hat es wohl gegeben. Ich weiß nicht, ob der BND die Amerikaner mit mehr Nachdruck hätte warnen müssen. Für die Amerikaner war es offensichtlich eine tolle Gelegenheit, weil sie durch Curveball und seine Schilderung von der Herstellung chemischer Massenvernichtungswaffen im Irak einen offiziellen Grund für die Invasion der Koalition der Willigen bekommen haben. Der Regierung von Gerhard Schröder muss man das Nein zum Irakkrieg zugutehalten, auch wenn sie die Amerikaner trotzdem unterstützt haben.
Zur Person

© Hans Scherhaufer
Oliver Bottini, 59, hat Germanistik, Italianistik sowie Markt- und Werbepsychologie studiert. Seit Anfang der 2000er Jahre hat er sich einen Namen als Autor von Kriminalromanen gemacht.
Für „Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens“ (2017) wurde er mit dem Deutschen Krimi Preis sowie dem Preis der Heinrich-Böll-Stiftung für den besten politischen Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet.
2015 und 2016 wurden für die ARD zwei seiner Kriminalromane erfolgreich verfilmt, in deren Mittelpunkt die Figur der trockenen Alkoholikerin Louise Boni steht.
Sie haben den Roman „Einmal noch sterben“ parallel zum Drehbuch von „Das zweite Attentat“ entwickelt. Wer lag bei dem Rennen häufiger vorn: der Roman oder das Drehbuch?
Das war auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Rennen, quasi ein Hürdenlauf. Das habe ich deutlich unterschätzt. Ausgangspunkt war die Grundidee für eine Fernsehserie, die ich 2016 dem Produzenten Mario Krebs von Eikon Media vorgestellt habe. Sie gefiel ihm gut und er sagte: Mach da mal weiter. Nach zwei Jahren gingen wir gerade ins Treatment. Weil ich noch immer nicht wusste, ob das jemals realisiert wird, dachte ich mir, ich schreibe dann doch parallel einen Roman, wenn ich mich ohnehin in die Thematik eingearbeitet habe. Als dann vom WDR die Serie bestätigt wurde, musste zunächst die Arbeit daran verstärkt werden. Der Erscheinungstermin für den Roman hat sich darum verschoben. Die Arbeit für die Serie war dann phasenweise wichtiger, weil sich TV-Budgets ja nicht so einfach verschieben lassen und das Team und der Druck immer größer wurde.
Wir haben sicherlich den Fehler gemacht, viel zu spät in den Writers Room gegangen zu sein.
Für Oliver Bottini war die Serie zugleich das Debüt als Drehbuchautor
Zusammen mit Ihnen saßen am Ende für die Serie fünf Autoren im Writers Room. Klingt nach Stress pur?
Wir haben sicherlich den Fehler gemacht, viel zu spät in den Writers Room gegangen zu sein. Lange Zeit dachten wir, dass ich die Serie allein stemmen kann. Das war ein bisschen blauäugig, vor allem von mir. Erst fünf Monate vor Drehbeginn kamen Julia Neumann und Benjamin Karalic als zusätzliche Autoren dazu, die die ersten vier Folgen überarbeitet haben. Und weil wir später die Sorge hatten, mit den letzten beiden Folgen nicht fertig zu werden, kümmerten sich Ulf Tschauder und Christoph Darnstädt um die Überarbeitung dieser Episoden.
Wie unterscheidet sich die Arbeit am Roman an der für eine Serie?
Der inhaltliche Hauptunterschied besteht jedenfalls darin, dass der Roman nur das Jahr 2003 abdeckt. Die Gegenwartsebene war der Wunsch des WDR. Aber auch Mario Krebs und ich fanden die Idee reizvoll. So haben wir nach vielen Gesprächen die Handlung um Alex Jaromin als Sohn des Roman-Protagonisten Frank Jaromin aufgebaut. Im Roman erzähle ich hingegen viel mehr über die politischen Hintergründe sowie über die Menschen im Irak, und was die Sanktionen und der Krieg für sie bedeuteten. Das hätte in die Serie dann nicht hineingepasst.
Die Darstellung von Gewalt fällt in der Serie sehr explizit aus. Warum?
Im Drehbuch ist das weniger stark ausgeprägt. Mir reicht es aus, wenn gesagt wird: Er richtet die Pistole auf ihn und schießt. Mehr brauche ich nicht. Am Set hat dann Barbara Eder, die Regisseurin, ihre Akzente gesetzt. Hinzu kommt, dass wir anfangs dachten, die Serie sei für die Mediathek und erst mal nicht für das lineare Programm gedacht. Da kann man ja viel expliziter arbeiten und komplexer erzählen. Damit verbunden war für mich auch das gute Gefühl, dass ich mich dadurch an den großen Netflix-Produktionen oder an Amazon, HBO oder wem auch immer orientieren konnte.