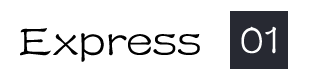Vor der spanischen Südküste hat an diesem Montag ein beeindruckendes Schauspiel begonnen. 30 Kriegsschiffe aus neun Nato-Staaten versammeln sich hier zu einem Großmanöver. Bis zum 4. April sollen in der Bucht von Cádiz 4000 Soldatinnen und Soldaten der Seestreitkräfte ihre Kampfkraft „in einem multinationalen Szenario“ erproben sowie neue Technologien testen, ließ das spanische Verteidigungsministerium wissen. Mit dabei ist erstmals auch die neueste Errungenschaft der spanischen Armada, das U-Boot Isaac Peral.
Das mehr als 80 Meter lange Hightech-Unterseeboot wurde in Spanien entworfen und gebaut und kostete Spaniens Steuerzahler über 20 Jahre hinweg mehr als 3,6 Milliarden Euro. Benannt wurde es nach einem Nationalhelden: Isaac Peral hatte am Ende des 19. Jahrhunderts in Cartagena das weltweit erste elektrisch betriebene U-Boot entwickelt. In der Hafenstadt, wo nun auch das neue U-Boot gebaut wurde, ist ihm ein prominentes Denkmal gesetzt.
Neben Island ist Spanien das Schlusslicht in Sachen Verteidigungsausgaben
Doch weder die Erinnerung an die Geschichte der einst so stolzen spanischen Armada, noch das von Spanien angeführte Nato-Manöver können derzeit darüber hinwegtäuschen, dass die Regierung von Pedro Sánchez reichlich Probleme mit dem brisant gewordenen Thema Aufrüstung hat. Sánchez steht vor der kaum lösbaren Aufgabe, die pazifistische Haltung seiner eigenen, links-sozialistischen Regierung mit den Forderungen der Nato-Bündnispartner nach erhöhten Rüstungsausgaben in Einklang zu bringen.
Sieht man vom Nato-Partner Island ab, das keine Armee hat, ist Spanien im Bündnis das Schlusslicht, was die Verteidigungsausgaben betrifft. Knapp 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gibt das Land für das Militär aus, und weil die Wirtschaft deutlich wächst, droht diese Quote sogar noch zu sinken. Um das Nato-Mindestziel von zwei Prozent zu schaffen, müsste Spanien die derzeit jährlichen Ausgaben von 20 Milliarden Euro massiv steigern.
Noch vor Kurzem peilte die Regierung Sánchez an, das Zwei-Prozent-Ziel bis zum Jahr 2029 zu erreichen. Diese eher gemächliche Planung war ein Zugeständnis an die linken, militärkritischen Kräfte im Parlament, deren Zustimmung der Premier für seine Regierungsarbeit braucht. Doch angesichts der Stimmungslage im Verteidigungsbündnis ist der Druck nun gestiegen.
Der Premier spricht lieber von „technischen Fortschritten“ in der Verteidigung
Sánchez muss, wenn er seine EU- oder Nato-Partner in Brüssel trifft, wo sich Spaniens fließend Englisch sprechender Premier durchaus wohlfühlt, ehrlicherweise bekennen, dass er daheim in Madrid große Schwierigkeiten hat, die eigenen Regierungspartner vom Nato-Engagement zu überzeugen.
Sánchez' wichtigster Koalitionspartner, das Linksbündnis Sumar, das immerhin fünf der 22 Ministerien in seinem Kabinett anführt, verpasste dem Premier bei einer Parlaments-Abstimmung in der vergangenen Woche einen Tiefschlag. Sumar folgte dem Antrag einer Splitterpartei aus Galicien, die Militärausgaben nicht zu erhöhen. Nur mit den Stimmen der Opposition wurde der Vorstoß abgewendet.
Um Sumar und weitere Linksparteien zu besänftigen, erklärte Sánchez am vergangenen Donnerstag, dass er mit dem Begriff der „Wiederaufrüstung“ ganz und gar nicht einverstanden sei. „Ich denke, wir müssen anders reden, wenn wir über die Verbesserung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten reden“, sagte der Sozialist, zum Beispiel von „technischen Fortschritten“ in der Verteidigung. Damit orientierte er sich ostentativ an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die den Begriff geprägt hatte.
Sánchez probiert den Spagat
Auftritte wie dieser sind Symptome eines Spagats, den Sánchez zu bewältigen hat. An seiner Zustimmung zu den Nato-Plänen bestehen inhaltlich wenig Zweifel. Als der Posten des Nato-Generalsekretärs neu zu besetzen war, galt Spaniens Premier sogar als möglicher Kandidat. Sollte es der Friedenssicherung dienen, ist er gewillt, auch spanische Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Spanien sei ein „ernsthafter, verantwortungsbewusster und entschlossener Alliierter“, erkärte Sánchez im Januar, als Nato-Generalsekretär Mark Rutte ihn im Regierungskomplex in Madrid besuchte.
Fraglich ist nun, wie er zugleich die Nato-Pläne unterstützen und seine Koalition erhalten will. Dazu wird sich Sánchez am Mittwoch vor dem Parlament erklären. Das dürfte nicht nur mit Blick auf seine linken Koalitionspartner spannend werden. Auch von konservativer Seite gibt es Druck, allerdings in die Gegenrichtung. Der Partido Popular, die größte Fraktion im Kongress, will die Verteidigungsausgaben schnellstens mehr als verdoppeln.
So gesehen wäre es für Sánchez theoretisch möglich, das Verteidigungsbudget mit der Zustimmung der Opposition aufzumöbeln. Doch dem steht das in Spanien notorisch zerrüttete Verhältnis zwischen Linken und Rechten im Weg. Ganze 45 Minuten lang besprach sich Sánchez kürzlich mit dem Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo – mit dem einzigen Ergebnis, dass sich hinterher beide völlige Inkompetenz vorwarfen.
Zu den innenpolitischen Hürden kommt das in Spanien generell gespaltene Verhältnis zu militärischen Angelegenheiten. Zwar sehen Meinungsforscher derzeit eine knappe Mehrheit in der Bevölkerung für höhere Rüstungsausgaben. Doch noch immer lasten die Schatten des blutigen, einst vom eigenen Militär angezettelten Bürgerkriegs sowie der Diktatur des Generalísmo Francisco Franco auf der Gesellschaft. Die in Spanien stärker als anderswo ausgeprägte Nato-Skepsis liegt nicht nur in der größeren räumlichen Distanz zu Russland begründet, sondern auch in der Geschichte des eigenen Landes.
1982, sieben Jahre nach dem Tod des Diktators Franco, trat Spanien gegen den Widerstand der Sozialisten der Nato bei. Als die Sozialisten im Herbst des gleichen Jahres an die Macht kamen, vollzog Premier Felipe González eine Kehrtwende, die ihm viele bis heute verübeln: Der Sozialist unterstützte 1986 bei einem Referendum den Verbleib in der Nato. Und als der konservative Premier José María Aznar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Irakkrieg eintrat, verlor seine Partei die folgenden Parlamentswahlen.