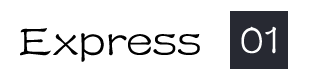Das Ende war fast schon doppeldeutig: „Lassen Sie uns an die Arbeit gehen“, schloss Julia Klöckner (CDU) ihre Antrittsrede im Bundestag am vergangenen Dienstag. Nun dürfte sich bisher kaum ein deutsches Parlament über zu wenige Aufgaben beschwert haben, aber der jüngst konstituierte 21. Bundestag dürfte noch einmal mehr zu tun haben. Da weiß auch seine frisch gewählte Präsidentin.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach.
Denn er tagt in unruhigen Zeiten. Das Vertrauen in die Institutionen sinkt, demokratiefeindliche Kräfte werden auch in Deutschland stärker, mit der AfD stellt eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei mit 152 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion.
Es sind Umwälzungen, auf die nicht nur die künftige Regierung Antworten finden muss – sondern auch das Parlament selbst. Aber vor welchen Herausforderungen steht der Bundestag in den kommenden vier Jahren? Und wie können diese bewältigt werden? Die drei wichtigsten Punkte.
Digitales Parlament
Wie es um die Digitalisierung im Bundestag steht, merkt man immer, wenn es etwas personell zu entscheiden gibt. Dann ziehen sich die Abgeordneten zurück, füllen handschriftlich Wahlzettel aus, werfen sie in bereitgestellte Urnen. Und wenn man Glück hat, kennt man rund eine halbe Stunde später das Ergebnis.
So war es auch am vergangenen Dienstag, als Julia Klöckner zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt wurde – und in ihrer Antrittsrede Besserung anmahnte. Das Parlament müsse moderner werden, sagte Klöckner. Und forderte die „funktionierende und benutzerorientierte Digitalisierung“ der parlamentarischen Arbeit.

© imago/Future Image/IMAGO/Frederic Kern
Nun ist der Wunsch nach mehr Digitalisierung eine beliebte politische Floskel – wenn auch oftmals im Kern richtig. Im Falle des Bundestags stellen sich jedoch zwei Fragen: Wie könnte ein digitales Parlament konkret aussehen? Und hätte dieses wirklich nur Vorteile?
Tatsächlich sind viele Parlamente schon deutlich weiter als der Bundestag. Im Europäischen Parlament in Brüssel stimmen die Abgeordneten etwa schon seit den 1980er Jahren digital ab, die Ergebnisse gibt’s in Echtzeit. Dokumente und Vorlagen liegen vollständig elektronisch vor.
Davon ist der Bundestag weit entfernt. Fragt man Abgeordnete nach dessen digitaler Vernetzung, erntet man Schulterzucken. Dokumente gebe es teils nur auf Papier, nicht alle Sitzungsräume seien vernetzt.
Der Bundestag könnte die Transparenz erhöhen, indem er online viel mehr verfügbar macht.
Markus Beckedahl, Digitalexperte über die Digitalisierung des Bundestags
Zudem setzt der Bundestag für Videokonferenzen weiterhin auf US-amerikanische Dienste wie „Zoom“ oder „WebEx“. Angesichts der irrlichternden Administration um Präsident Donald Trump halten dies viele für keine gute Idee.
Die Bundestagsverwaltung scheint sich des Nachholbedarfs bewusst zu sein. Im Mai 2023 gründete sie deshalb die Abteilung Digitalisierung, die die elektronische Weiterentwicklung des Parlaments vorantreiben soll.
Sven Vollrath, der die Abteilung leitet, ist stolz auf das bisher Geleistete: „Der Bundestag hat in den letzten Jahren die Digitalisierung seiner parlamentarischen und administrativen Aufgaben intensiv vorangetrieben“, sagt er. Man habe neue Technologien eingeführt und digitale Prozesse angestoßen.
Doch auch er sieht noch viel Arbeit vor sich: „Viele interne Prozesse im Bundestag müssen modernisiert und effizienter gestaltet werden“, sagt Vollrath. „Die digitale Kommunikation zwischen Abgeordneten, Fraktionen, der Verwaltung sowie auch den Bürgerinnen und Bürgern soll über digitale Angebote im Internet und im Intranet gestärkt werden.“
Das klingt gut, heißt aber eben auch, dass der Bundestag seine digitalen Möglichkeiten bislang nur unzureichend nutzt – etwa bei der Kommunikation mit den Bürgern.
Dabei halten Experten diesen Aspekt mit Blick auf das stetig sinkende Vertrauen in die demokratischen Institutionen für besonders wichtig. Markus Beckedahl, Gründer des Blogs „netzpolitik.org“ und digitalpolitischer Aktivist, fordert deshalb ein politisches Umdenken.
„Der Bundestag könnte die Transparenz erhöhen, indem er online viel mehr verfügbar macht“, sagt er. Unter dem derzeit geltenden Informationsfreiheitsgesetz können Bürger Anfragen stellen, um an Informationen zu kommen. Die Entscheidung darüber, ob dem stattgegeben wird, liegt bei den zuständigen Behörden.
Ich finde es gerade in den heutigen Zeiten besser, wenn sensible Wahlen mit Stift und Papier stattfinden.
Markus Beckedahl zeigt sich skeptisch gegenüber elektronischen Abstimmungen
Beckedahl hält das für „rückständig“: „Die Bundesregierung sollte das in Richtung eines Transparenzgesetzes umdrehen“, sagt er. „Eines, das Behörden grundsätzlich verpflichtet, einen größtmöglichen Teil an Dokumenten zu veröffentlichen, während über mögliche Ausnahmen im zweiten Schritt entschieden wird.“
Bezüglich digitaler Abstimmungen zeigt er sich jedoch skeptisch: „Ich finde es gerade in den heutigen Zeiten besser, wenn sensible Wahlen mit Stift und Papier stattfinden“, sagt er. „Wir verfügen schlicht nicht über vertrauenswürdige Hard- und Software dafür.“
Mehr Digitalisierung bedeutet schließlich in einer zunehmend vernetzten Welt immer weniger Sicherheit. Ein Umstand, den auch Abteilungsleiter Vollrath betont: „Die IT-Sicherheit muss in einem ständigen Prozess fortlaufend verbessert werden, um gegen allgegenwärtige Cyberbedrohungen gewappnet zu sein“, sagt er.
Politik und Familie
Die Zeiten sind lange vorbei, in denen sich die vielbeschäftigten Herren Abgeordneten darauf zurückziehen konnten, dass zu Hause eine Ehefrau Haus und Kinder versorgt. Auch die Mitglieder des Bundestags, Mütter wie Väter, haben Familienpflichten. Darauf aber ist der Parlamentsbetrieb nicht ausgelegt.
Denn der Job ist per se alles andere als familienfreundlich. Wer für den Bundestag kandidiert, weiß, dass er in Zukunft zwischen dem eigenen Wahlkreis und der Hauptstadt zu pendeln haben wird. Keine Parlamentsreform der Welt wird das ändern können.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Und doch gibt es konkrete, kleinere Wünsche, deren Erfüllung es Abgeordneten leichter machen würde, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Es wären kleine Schritte, mit denen sich der Kosmos Bundestag modernisieren ließe.
Los geht es bei der Regel, dass keine außenstehenden Personen den Plenarsaal betreten dürfen, wenn das Parlament tagt. Auch ein schlafendes Neugeborenes in der Babytrage fällt unter diesen Bann, und schon so manche Abgeordnete, die Mutter geworden ist, hat sich darüber geärgert.

© imago/pictureteam/IMAGO/Matthias Gränzdörfer
Ein Umstand, den auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei ihrer Antrittsrede am vergangenen Dienstag ansprach: „Wir müssen uns mehr anstrengen, um mehr Frauen in die Politik und in die Parlamente zu holen“, sagte sie mit Blick auf die mit weniger als einem Drittel besonders niedrige Frauenquote im 21. Bundestag. „Dazu gehört nicht nur, aber auch, eine bessere Vereinbarkeit von Politik und Familie.“
Was die Mitglieder des Bundestags ebenfalls oft beklagen, sind die vielen Nachtsitzungen. Oft wurde alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Doch die Abgeordneten sitzen lange Stunden in Beratungen ab. Ginge das besser?
Mit einem Familiensonntag ohne Termine und Telefonate wäre schon viel getan.
Abgeordnete Christina Stumpp (CDU) über Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit von Politik und Familie
Es ist eine sehr grundsätzliche Frage, die die Debattenkultur des Parlaments als solche in Frage stellt, ganz unabhängig von dem besonders dringenden Wunsch nach Veränderung bei allen, die kleine Kinder haben. Wenn die noch nicht schulpflichtig sind und in den Sitzungswochen mit nach Berlin kommen, schmerzen lange Nachtsitzungen die Eltern doppelt.
Immerhin: Wer als Mutter noch stillt, kann sich abends und nachts von namentlichen Abstimmungen entschuldigen lassen. Solche Tipps reichen die Mütter des Bundestags auf kurzem Dienstweg untereinander herum.
Viele leiden an der Zerrissenheit zwischen Beruf und Kindern. „Mit einem Familiensonntag ohne Termine und Telefonate wäre schon viel getan“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp im vergangenen Jahr dem Tagesspiegel.
Damals hatte der grüne Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler gerade angekündigt, nicht noch einmal für den Bundestag zu kandidieren. Er wolle mehr Zeit für die Familie. „Eine gleichberechtigte Elternschaft und Spitzenpolitik sind nicht vereinbar“, sagte er damals dem „Spiegel“.
Sichere Demokratie
Für viele im politischen Berlin war der 29. August 2020 so etwas wie ein Dammbruch. An diesem Tag versuchten im Rahmen einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, an denen auch Verschwörungsideologen, Rechtsextremisten und Reichsbürger teilnahmen, rund 400 Personen, den Bundestag zu stürmen. Dabei wurden Absperrungen überwunden, aber der Angriff konnte von anwesenden Beamten zurückgeschlagen werden.
Aber allein durch den Versuch hat eine simple Frage neue Brisanz gewonnen: Wer schützt eigentlich das deutsche Parlament?

© IMAGO/Achille Abboud
Die kurze Antwort: die Bundestagspolizei. Also eine Truppe von rund 200 Polizisten, die sich zum Großteil aus Abgesandten der Bundespolizei zusammensetzt. Ihre Aufgabe: Den Bundestag, seine Abgeordneten und deren Mitarbeiter zu schützen.
Doch seit Jahren mehren sich die Zweifel, ob sie für diese Aufgabe ausreichend gerüstet ist – sowohl personell als auch auf gesetzlicher Ebene. Schließlich war der versuchte Sturm auf den Reichstag vom August 2020 nicht das einzige Ereignis dieser Art.
Am 18. November desselben Jahres hatten Mitglieder der AfD-Fraktion Personen in den Bundestag eingeladen, die der Verschwörungs-Szene nahestehen. Diese bedrängten, verfolgten und beschimpften mehrere Abgeordnete, unter anderem den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Zudem drangen einige der „Gäste“ in Abgeordnetenbüros ein.
Eine der betroffenen Abgeordneten berichtet heute davon, dass dieses Ereignis „alles verändert“ habe. Ein Mitarbeiter spricht von großer Angst, man habe sich danach einen Baseballschläger ins Büro gestellt – zum Selbstschutz.
Zwei Jahre später wurde zudem bekannt, dass die ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann mehrmals sogenannte Reichsbürger der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß durch den Bundestag geführt hat. Diese hätten dort Fotos und Videos gemacht. Das Ziel der Gruppe: Der Umsturz des politischen Systems mit Waffengewalt.
Dieser Gemengelage steht die Bundestagspolizei mit einem bemerkenswerten Konstrukt gegenüber. Denn sie untersteht laut Artikel 40 des Grundgesetzes allein der Bundestagspräsidentin und darf nur innerhalb der Parlamentsgebäude aktiv werden. Das sollte historisch die Unabhängigkeit des Parlaments stärken.
Im Alltag ist dadurch aber oft unklar, wie weit die Beamten wann gehen dürfen. Sowohl bei einem Angriff von außen als auch bei Verdachtsmomenten innerhalb des Hauses.
„Das ist sehr abstrakt“, sagte die ehemalige Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zuletzt. „Es geht darum, die Befugnisse endlich auf eine klare Rechtsgrundlage zu stellen.“
Deshalb forcierte Bas in ihrer Amtszeit ein eigenes Bundestagspolizeigesetz. Dieses sollte unter anderem die Befugnisse der Beamten erweitern und ihre Zuständigkeit regeln.
Der Antrag war eigentlich fraktionsübergreifend geplant, doch der Bruch der Ampel kam dazwischen. Bas drängte darauf, das Gesetz noch vor den Neuwahlen durch den Bundestag zu bringen – und scheiterte am Widerstand der Union.
SPD-Politiker, die am Gesetzesentwurf beteiligt waren, wollen sich mit Verweis auf die laufenden Koalitionsverhandlungen nicht öffentlich zu den Vorgängen äußern. Hinter vorgehaltener Hand sagt jedoch einer, die Union habe blockiert, weil sie Bas den Erfolg nicht gegönnt habe. In der CDU weist man das zurück. Man habe schlicht inhaltliche Bedenken gehabt, heißt es.
Ob das Mandat der Bundestagspolizei in naher Zukunft gestärkt wird, ist dennoch fraglich. Denn in den bisher bekannten Verhandlungspapieren zwischen Union und SPD findet sich dazu nichts Neues. Die SPD fordert weiterhin „eine rechtliche Grundlage“, wie es im Abschlusspapier der Arbeitsgruppe Inneres und Recht heißt. Die Union schweigt dazu.
Dabei wäre dies dringend nötig, wie eine ehemalige Abgeordnete mit Blick auf die AfD-Fraktion sagt: Deren Mitarbeiter, sagt sie, führten sich teils auf wie Schlägertrupps.