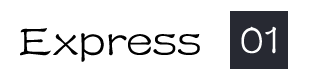Egal ob beim Friseurbesuch oder auf der Wohnungssuche – in Deutschland hat jeder Mensch einen gesetzlichen Anspruch auf Gleichbehandlung. Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, des Glaubens, Geschlechts oder der eigenen Sexualität eine Benachteiligung erfahren. Die Realität auf den deutschen Straßen sieht für viele Minderheiten anders aus. Besonders Musliminnen und Muslime sehen sich seit Jahren steigenden Anfeindungen ausgesetzt. 68 Prozent von ihnen erlebten nach Angaben der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2024 rassistische Diskriminierung, das ist einer der höchsten Werte in der EU.
Wie viele solcher Erfahrungen es tatsächlich in Deutschland gibt, lässt sich kaum verlässlich sagen. Bislang kümmern sich vor allem zivilgesellschaftlich organisierte Stellen um die Erfassung derartiger Fälle in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen startet nun am 17. März eine Landesmeldestelle für antimuslimischen Rassismus, die das Dunkelfeld weiter aufhellen soll. Mehr als 375 000 Euro wurden dabei in das Projekt investiert.
Gleichzeitig nehmen auch Meldestellen für Queerfeindlichkeit, Antiziganismus und für Rassismus gegen schwarze und asiatische Menschen ihre Arbeit auf. Aber: „Die Meldestellen prüfen keine Vorfälle auf Strafbarkeit und sie haben keinen Verfolgungs- oder Sanktionierungsauftrag“, heißt es aus dem zuständigen Ministerium.
Frauen erfahren häufiger Diskriminierung als Männer
Es gehe lediglich darum, das Ausmaß des Problems zu verstehen. Den Weg zu Polizei und Anwälten müssen Betroffene nach wie vor selbst suchen. Dabei beklagen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch (HRW), den Anstieg von antimuslimischem Rassismus in Deutschland. Es gebe weder eine Arbeitsdefinition für diese Form von Rassismus noch offizielle Daten oder Investitionen in die institutionelle Unterstützung der Betroffenen, so HRW. Letztlich fehle der Bundesregierung die Einsicht, dass es sich dabei überhaupt um Rassismus handele, nicht nur um religiöse Anfeindungen. Der Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung kam 2023 zu dem Schluss, dass Menschen den Islam besonders häufig als bedrohlich wahrnehmen.
Die Einrichtung einer Meldestelle wie in Nordrhein-Westfalen sei ein wichtiger erster Schritt, findet Rima Hanano. Sie ist Leiterin der Organisation Claim, die seit 2021 ein bundesweites Monitoring-Projekt für antimuslimische Vorfälle organisiert. „Es braucht zusätzlich Empowerment-Angebote, gute Vernetzung und Beratungsstrukturen.“ Vor allem gebe es aber aufseiten der Polizei kein einheitliches System, um antimuslimische Vorfälle zu erfassen. In den Auswertungen des Bundesinnenministeriums wird nach wie vor der Begriff der Islamfeindlichkeit verwendet. „Damit ist erst mal ein Motiv aufgrund der Religionszugehörigkeit gemeint“, so Hanano. Fälle ohne sichtbaren Religionsbezug würden so ausgeblendet, ohnehin gehe es ja nur um strafrechtlich relevante Taten.
Betroffene haben Angst, sich an die Polizei zu wenden
Aus dem jüngsten Lagebild der Claim-Allianz geht hervor, dass es 2023 in Deutschland im Schnitt fünfmal am Tag zu antimuslimischen Straftaten, Beleidigungen oder Diskriminierungen kam. In der Regel richtet sich die Diskriminierung gegen Einzelpersonen, in den meisten Fällen Frauen. Aber in dem Bericht sind diskriminierende Flyer, Plakate oder Hassrede im Netz nicht enthalten. Die insgesamt 1926 verzeichneten Fälle seien nur die „Spitze des Eisbergs“ schreibt Claim, und längst nicht alle Vorfälle würden gemeldet. Teils wüssten Betroffene nach wie vor nichts von den Meldestellen, teils sei der Rassismus bereits normalisiert, die eigenen Rechte unbekannt. Diverse Betroffene würden sich zudem aus Angst nicht an die Polizei wenden, hätten fehlendes Vertrauen in staatliche Behörden und Institutionen.
Der Claim-Bericht skizziert zudem einige Fälle, die typisch für antimuslimische Erfahrungen in Deutschland sind – Beleidigungen auf offener Straße, heruntergerissene Kopftücher; ein Mann sei als Terrorist bezeichnet und attackiert worden.
Es geht allerdings nicht nur um menschenfeindliche Parolen oder körperliche Übergriffe. Der Alltagsrassismus nimmt verschiedenste Formen an, wie Aylin Bayram der Süddeutschen Zeitung schildert. Sie möchte ihre Geschichte nur unter geändertem Namen erzählen. Die Studentin trägt einen Hidschab, also ein Kopftuch. Als sie in einem nahe gelegenen Fitnessstudio zum Probetraining erscheint, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. „Die Dame an der Anmeldung war schon komisch“, erzählt Aylin. Sie habe sie auf den Hidschab angesprochen und gefragt, ob sie tatsächlich einen Termin in dem Studio hätte. Als sich die Studentin im Anschluss an das Training um eine Mitgliedschaft bemüht, sei sie von der Dame am Empfang abgewiesen worden – die Wartezeit sei wohl noch zu lang.
Auch ein Telefonat mit der Studioleitung habe Aylin schließlich nicht weitergebracht. Erst als sie sich an eine örtliche Beratungsstelle wendet und einen Anwalt einschaltet, gibt das Studio nach, erlässt gar die ersten Monate der Beitragszahlungen. Eine mögliche Diskriminierung weist es dennoch von sich. Für Aylin ist das wenig überzeugend. In der Zwischenzeit hatte sie ihre Schwester beauftragt, sich ebenfalls in dem Studio anzumelden – allerdings unter deutschem Namen, diesmal ohne abgewiesen zu werden.
Erkenntnissen des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit zufolge ist die Diskriminierungsform kein gesellschaftliches Randphänomen, sondern in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet. Schirin Amir-Moazami arbeitet an der Freien Universität Berlin zu dem Thema. Auch sie begrüßt Projekte wie die Landesmeldestelle in Nordrhein-Westfalen, stellt aber klar: „Rassismus existiert nicht nur auf individueller Ebene, sondern ist auch strukturell und institutionell verankert.“ Die Meldestellen sollten daher unbedingt an zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Einrichtungen gekoppelt sein, findet Amir-Moazami. Immerhin – die neue Einrichtung in NRW liegt in der Trägerschaft zweier regionaler Vereine. Die Ergebnisse sollen nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet werden, so das Ministerium. Der erste Jahresbericht ist 2026 zu erwarten.