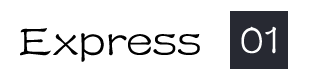Es gibt Länder in Europa wie Finnland, Polen und die baltischen Staaten, die seit Jahren vor der Bedrohung durch Russland warnen und längst entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Daneben gibt es Länder wie Deutschland, wo erst in letzter Zeit die Erkenntnis eingesickert ist, dass man zwischen dem imperialistischen Moskau und dem unberechenbaren Washington womöglich selbst etwas mehr für die eigene Sicherheit tun muss. Und dann gibt es noch die Schweiz.
In Bern hat man wahrscheinlich mitbekommen, was gerade auf der Welt passiert. Nur wurde in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten mindestens so viel sogenannte Friedensdividende ausgezahlt wie in den meisten anderen europäischen Ländern. Die Armee ist also entsprechend in mindestens so schlechtem Zustand wie die Bundeswehr. Viele Systeme sind völlig veraltet, die Luftraumüberwachung muss dringend modernisiert und Drohnen müssen angeschafft werden, die Logistik ist mangelhaft und die Munition nicht mehr zeitgemäß.
Ende Februar legte der Bundesrat, die Schweizer Regierung, deshalb einen ersten Plan über zumindest 1,7 Milliarden Franken (knapp 1,8 Milliarden Euro) zur Modernisierung der Streitkräfte vor. Ein winziger Betrag im Vergleich zu den Ausgaben, die in anderen europäischen Ländern vorgesehen sind. Unter anderem sollen Artilleriesysteme und Minidrohnen angeschafft sowie die kurzfristig wahrscheinlich relevanteren „Fähigkeitslücken“ bei der Cyberabwehr und der elektronischen Kriegsführung zumindest teilweise geschlossen werden.
Gleich drei wichtige Posten müssen nun neu besetzt werden
Diskutiert wird unter anderem aber auch, was mit der Kunstfliegerstaffel „Patrouille Suisse“ geschehen soll, deren völlig veraltete Flugzeuge vom Typ F-5 Tiger Ende 2027 außer Dienst gestellt werden. 2024 war für die kampfuntauglichen Maschinen noch ein Budget von 44 Millionen Franken eingeplant gewesen. Insgesamt scheint man sich in Bern aber einig zu sein, dass die Verteidigungsfähigkeit der Armee grundsätzlich wiederhergestellt werden soll.
Ausgerechnet in dieser Zeit der hereinbrechenden Realpolitik werden die Schweizer Armeeführung, das Verteidigungsdepartement und die Rüstungsindustrie auch noch von einer ganzen Reihe von Rücktritten und Skandalen erschüttert. Bereits im Januar verkündete die Bundesrätin und Leiterin des Verteidigungsdepartements, Viola Amherd (Die Mitte), ihren Rücktritt für Ende März, also während der laufenden Legislaturperiode. Ein Nachfolger soll kommenden Mittwoch gewählt werden. Ob der dann auch die Leitung in Verteidigungsfragen übernehmen wird, ist aber unklar. Womöglich werden die Zuständigkeiten neu sortiert. Ein Überschuss an Bewerbern herrscht nämlich nicht.
Denn neben der mehr oder weniger kompletten Neuaufstellung der Armee müssen auch die Posten des Armeechefs und des Nachrichtendienstchefs neu besetzt werden. Thomas Süssli und Christian Dussey hatten beide ebenfalls im Januar ihre Kündigungen eingereicht. Aus unbekannten Gründen gab Amherd die Rücktritte aber bisher nicht bekannt, sie wurden Ende Februar an die Medien durchgestochen. Zwar legen die Chefs ihre Ämter erst Ende des Jahres beziehungsweise im März 2026 nieder. Dennoch ist das keine glückliche Zeit, um nun gleich drei kritische Posten neu besetzen zu müssen. Dazu kommt, dass beim Schweizer Nachrichtendienst in den vergangenen Jahren ein Drittel des Personals gegangen ist. Laut einer Umfrage herrscht in dem Dienst große Unzufriedenheit, vor allem mit der Führungsebene.
Viele Verbündete sind wegen des restriktiven Kriegsmaterialgesetzes verärgert
Amherds Kollegen im Bundesrat sollen von den Kündigungen aus der Zeitung erfahren haben, was Fragen zum Vertrauensverhältnis innerhalb der Schweizer Regierung aufwirft. Ende Februar zählte Amherd bei einer Pressekonferenz eine Reihe von ihr vorgeschlagener Maßnahmen zur Verbesserung der „Verteidigungsfähigkeit“ auf, die alle vom Bundesrat abgelehnt worden seien. Die Personalien und der offenbar uneinige Bundesrat sind aber nur die eine Großbaustelle für das neue Bundesratsmitglied.
Die andere ist die Schweizer Rüstungsindustrie, die gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen hat. In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Ruag das Unternehmen um einen zweistelligen Millionenbetrag betrogen haben soll. Dabei ging es unter anderem um Ersatzteile für die Panzer vom Typ Leopard in der niederländischen Armee.
Dazu kommt, dass Bern wegen des restriktiven Kriegsmaterialgesetzes viele europäische Verbündete stark verärgert hat. Die Schweizer Regierung hatte die Weitergabe von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard aus deutschen Beständen an die Ukraine blockiert, weil die Patronen ursprünglich aus der Schweiz stammten.
Die Schweiz verlässt sich auf den Schutz der Nato, ohne selbst Mitglied zu sein
Die Niederlande haben den Kauf von Schweizer Rüstungsgütern bereits eingestellt, auch Deutschland will möglichst keine Rüstungsgüter mehr aus der Schweiz – aus Sorge, diese in einem Kriegsfall nicht an andere EU-Länder weitergeben zu dürfen. Längst ist es zum geflügelten Wort geworden, Deutschland wolle in der Schweiz nicht mal mehr ein Tarnnetz kaufen. Auch Spanien und Dänemark hatten schon im vergangenen Jahr ähnliche Schritte erwogen.
Die Schweiz verlässt sich derzeit auf den Schutz der sie umgebenden Nato-Mitglieder, auch, um dabei selbst Geld zu sparen. Bis 2032 sollen die Ausgaben für die Armee auf gerade mal ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert werden. Die Nato empfiehlt zwei Prozent, viele Länder in Europa kalkulieren längst mit drei und mehr, um Russland effektiv abzuschrecken – und damit indirekt auch die Schweiz zu schützen. Um diese Haltung zu rechtfertigen, beruft man sich in Bern stets auf die Neutralität. Im Schweizer Parlament gehen die Haltungen dazu aber inzwischen deutlich auseinander.
Die rechtsnationale SVP wendet sich offen dem Trumpismus zu und forderte in dieser Woche unter anderem den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen sowie aus der Weltgesundheitsorganisation. Andere Parteien im Schweizer Parlament suchen dagegen mehr Nähe zu Europa: Am Donnerstag empfahl der Nationalrat mit deutlicher Mehrheit, „Möglichkeiten zur sicherheitspolitischen Kooperation mit der EU zu prüfen“. In einer Pressekonferenz am Freitag ließ die amtierende Bundespräsidentin Keller-Sutter wissen, man habe das zur Kenntnis genommen. International setze man weiter auf gute bilaterale Beziehungen. Auch zu den USA. Nach wenigen Minuten ging man zur innenpolitischen Tagesordnung über.
Die Nationalrätin Nicole Barandun (Die Mitte) sagte zur Lage ihres Landes während der Parlamentssitzung am Donnerstag: Die Welt brenne lichterloh, und die Schweiz überlege aber noch, ob sie sich an der Feuerwehr beteiligen wolle.