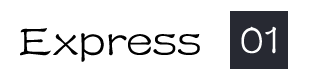Die Berliner Brasch-Festspiele gehen in die nächste Runde. Nachdem Jürgen Kuttner am Deutschen Theater mit seiner Inszenierung „Halts Maul, Kassandra“ im November eine Tiefenbohrung im Leben Thomas Braschs unternommen hat, widmete die Schriftstellerin Marion Brasch ihrem toten Bruder Thomas vor einigen Tagen am Berliner Ensemble einen Abend zum 80. Geburtstag. Jetzt inszeniert Lena Brasch, die Tochter von Kuttner und Marion Brasch, im Studio des Maxim Gorki Theaters eine Aufführung mit Texten ihres Onkels.
Die Exegese von Person und Werk Thomas Braschs an Berliner Bühnen bleibt in der Familie, was in diesem Fall übrigens eine ausgesprochen gute Nachricht ist. Wem das 24 Jahre nach dem Tod des Dichters mit gerade mal 56 Jahren noch nicht genug Gedenkfeier sein sollte, kann sich natürlich auch in der ARD-Mediathek Andreas Kleinerts grauenvoll mackerhaften, in Geniekult-Kitsch badenden Brasch-Film „Lieber Thomas“ anschauen oder in den 877 Seiten des vor Kurzem bei Suhrkamp erschienenen Bandes mit der gesammelten Brasch-Prosa blättern („Du mußt gegen den Wind laufen“). Erfreulicherweise hat Lena Braschs sehr lässige, kluge und persönliche Inszenierung im Gorki Studio („Brasch – Das Alte geht nicht und das Neue auch nicht“) in keiner Sekunde den unangenehmen Beigeschmack parasitärer Nachruhm-Verwertung der Legende vom wilden DDR-Beatnik. Das liegt unter anderem daran, dass man bekannte Brasch-Zeilen („vor den Vätern sterben die Söhne“, „und über uns schließt sich ein Himmel aus Stahl“) hier wie zum ersten Mal hört. Sie klingen an diesem Abend, als kämen sie direkt aus der Gegenwart und einem unbehausten, fast schutzlosen, wütenden Lebensgefühl, kurz bevor die AfD das Land übernimmt.
Jasna Fritzi Bauer singt die Verse „wovon träumen die Maschinen“ als elegischen Techno Track
Anders als Kuttner, der mit seiner Brasch-Inszenierung so etwas wie Ausgrabungsarbeiten in deutsch-deutscher Geschichte und versunkener kommunistischer Ideologie unternimmt, und erst recht anders als der leicht klebrige Outcast-Heldenkult des Biopics, benutzt Lena Brasch in ihrer Inszenierung das Werk Thomas Braschs wie einen Steinbruch. Sie nimmt die Sätze und Szenen, die sie gebrauchen kann, um daraus etwas ziemlich Eigenes zu machen, zum Beispiel melancholischen Pop (Musik: Paul Eisenach, Wenzel Krah).
Die Dekontextualisierung tut den gesampelten Brasch-Zeilen ausgesprochen gut. Jasna Fritzi Bauer singt die Verse eines Gedichts („wovon träumen die Maschinen“) als einen sehr elegischen Techno Track im Nebel. Klara Deutschmann und Edgar Eckert werfen sich die Dialogfetzen zwischen einem Desperado und einer Sexarbeiterin aus dem Stück „Mercedes“ zu. Plötzlich klingt der Anarcho-Romantizismus, ein intelligenter Mensch könne eigentlich nur „Künstler oder Krimineller“ werden, wie aus einem frühen Godard-Film, also sehr cool, und nicht mehr wie eine breitbeinige Brecht-Imitation.
Die anstrengende Pose, mit der sich Brasch ein wenig zu penetrant zum Klassiker stilisiert, ist wie weggeblasen. Spröde Gedichtzeilen („wie viele sind wir eigentlich noch“) wirken wie eine Flaschenpost, die letzten Mitteilungen eines Fremden oder eines fernen Freundes. Weil in Braschs Werk die Gewaltgeschichte Deutschlands immer sehr präsent ist, wird eine Traumaufzeichnung zum Bericht heutiger Schrecken: „Ein Mann ohne Kopf und voller Wunden schreit, der Krieg fängt an.“ Jasna Fritzi Bauer sagt das mit Härte, aber auch in sachlicher Selbstverständlichkeit: Das ist die Welt, in der wir leben.