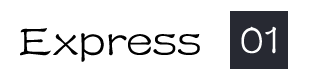Holger Klein ist der Kapitän eines Tankers. Eines riesigen, behäbigen Tankers, der in den goldenen Zeiten immer weiter aufgepumpt wurde. Seine Vorgänger an der Spitze von ZF Friedrichshafen kauften Wabco und TRW, und machten daraus den viertgrößten Autozulieferer weltweit. Größtenteils auf Pump, also schuldenfinanziert. Das Geschäft lief ja, und die Entschuldung zunächst auch. Doch dann braute sich was zusammen.
Erst kam Corona und mit ihm Lieferengpässe, der Angriff Russlands auf die Ukraine, die Energiekrise, und die E-Auto-Prämie fiel weg, die Kaufkraft sank, die chinesische Konkurrenz wurde stärker. „Noch nie befand sich unsere Branche so klar mitten im perfekten Sturm“, sagte Klein am Donnerstag, als er die enttäuschenden Geschäftszahlen verkündete. Der ZF-Tanker wankt.
2024 sank der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um mehr als elf Prozent auf 41,4 Milliarden Euro. ZF machte mehr als eine Milliarde Euro Verlust, nach einem Gewinn von 126 Millionen Euro im Vorjahr. Vor allem die Zinszahlungen für die auf 10,5 Milliarden Euro gestiegenen Schulden belasten die Bilanz. Klein nannte Gründe fürs schlechte Ergebnis: die schwächelnde Elektromobilität, Kunden, die sparen müssen, protektionistische Politik und hohe Kapitalkosten. ZF steht noch schlechter da als andere Zulieferer: Bosch und Mahle etwa mussten auch einen Umsatzrückgang hinnehmen, bleiben aber profitabel.
Wie will Holger Klein ZF da herausmanövrieren? „Wir wollen den großen Tanker ZF in eine starke Flotte von wendigen Schnellbooten transformieren“, sagte er. Womit er sagen will: Geschäftsbereiche werden ausgegliedert und teils verkauft. Damit hat ZF schon begonnen: Sein Achsmontage-Geschäft hat ZF in ein Joint Venture mit Foxconn überführt. Und die passiven Sicherheitssysteme, also etwa Airbags und Sicherheitsgurte, sind gebündelt in der ZF Lifetech. Es gibt offenbar einige Interessenten, auch ein Börsengang steht zur Debatte. ZF ist als Stiftungskonzern nicht an der Börse gelistet.
Auch sein Kerngeschäft bereitet ZF gerade auf einen Teilverkauf vor: Die Antriebssparte mit ihren 32 000 Mitarbeitern und einem Viertel Umsatzanteil hat vor allem im Elektrobereich wegen der geringen Nachfrage riesige Überkapazitäten. Gerade wird sie vom Mutterkonzern entflechtet, um ein agiles Schnellboot zu werden, wie Klein sagen würde. Nun ist ZF auf der Suche nach einem Partner, der einsteigt, um die Investitionspower zu steigern. Ganz will ZF nicht verkaufen, sondern weiter die Hand darauf behalten. Wer einsteigen soll, dazu sagte Klein nichts.
Der Chef will außerdem die Stärken von ZF weiter ausbauen. Etwa mit Investitionen in die Division Fahrwerktechnik, also Bremse, Lenkung und Dämpfung, wo man weltweit führend sei. Die Spitzenposition als größter Nutzfahrzeugzulieferer habe man durch gezielte Investitionen ausgebaut. Auch in der Industrietechnik sieht Klein noch Potenzial: Aktuell stellt ZF ein Viertel der Getriebe für Windkraftanlagen her. Um sich unabhängiger vom schwächelnden Neuwagengeschäft zu machen, setzt ZF verstärkt aufs Ersatzteil- und Servicegeschäft. Als Chefaufseher hat Rolf Breidenbach ein Auge auf die Restrukturierung, er löste diese Woche Heinrich Hiesinger als Aufsichtsratschef ab.
Mehr als 160 000 Menschen beschäftigt ZF aktuell, etwa ein Drittel davon in Deutschland. Der Konzern will 14 000 Stellen hierzulande streichen, 2024 sind schon 4000 Jobs weggefallen. Ans laufende Geschäftsjahr hat Klein keine großen Erwartungen. Weil das Umfeld schwierig bleibe, rechnet er nicht mit Wachstum. Strukturell soll ZF sowieso eher schrumpfen als wachsen. Vom Tanker zu agilen Booten.