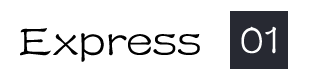Die Schweizer Pharmaunternehmen Roche und Novartis streichen ihre eigenen Vorgaben zur Diversität bei der Einstellung von Mitarbeitenden. Roche soll die Entscheidung diese Woche in einem internen Schreiben bekannt gegeben haben. Novartis bestätigte den Schritt auf Nachfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Man wolle aber dabeibleiben, „die besten Talente einzustellen und mögliche Benachteiligungen im Auswahlprozess zu reduzieren.“ Laut Roche habe die Entscheidung Auswirkungen „auf globaler Ebene“ – obwohl der Grund für diesen radikalen Kurswechsel im Weißen Haus sitzt.
Denn der neue US-Präsident Donald Trump führt einen Feldzug gegen alles, was für ihn irgendwie im Verdacht steht, mit „Gender-Ideologie“ oder „Wokeness“ zu tun zu haben. So sollen Hunderte Begriffe wie „Diskriminierung“ oder „Transgender“ aber auch „Rasse“ und „Geschlechte“ aus allen offiziellen Dokumenten der Regierung verbannt werden. Mit verschiedenen Erlassen versucht die Trump-Regierung außerdem, zum Beispiel transgeschlechtliche Personen wieder vom Militärdienst auszuschließen. Ob er mit diesen Maßnahmen überhaupt in großem Umfang durchkommt, ist noch nicht klar. Ein US-Gericht hat gerade erst den von Trump angeordneten Ausschluss von Transpersonen aus der Armee kassiert. Trotzdem folgen viele Unternehmen wie nun auch Roche und Novartis im vorauseilenden Gehorsam der Linie Trumps. Wahrscheinlich aus Angst vor ähnlich willkürlichen Schritten gegen sie. Diese Angst ist nicht ganz unberechtigt.
Der Pharmasektor ist für die Schweizer von sehr großer wirtschaftlicher Bedeutung
Im Februar hatte Trump angekündigt, neben Autos und Computerchips im Laufe des Jahres auch gegen Pharmaprodukte Zölle in Höhe von mindestens 25 Prozent erheben zu wollen. Damit sollen Unternehmen gezwungen werden, wieder mehr in den Vereinigten Staaten zu produzieren. Die Produktionsketten für Medizinprodukte sind allerdings stark globalisiert und zum Beispiel viele Grundstoffe für Medikamente werden in Asien produziert. Ein solches System lässt sich nicht einfach so umbauen. Da sich Trump von solchen Fakten aber in der Regel nicht beeindrucken lässt, versuchen die Schweizer Pharmaunternehmen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, indem sie ihr öffentliches Bekenntnis zur Diversität canceln.
Und das ist ohnehin nur eine der Maßnahmen, mit denen versucht wird, sich für den drohenden wirtschaftlichen Angriff Trumps auf die Europäische Union und ganz Europa zu wappnen. Die Schweiz, für die der Pharmasektor von sehr großer wirtschaftlicher Bedeutung ist, versucht derzeit auf dem bilateralen Weg, die schwersten Schäden bereits im Vorfeld abzuwenden. So reiste in dieser Woche eine Delegation des sogenannten Seco, das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, nach Washington.
Das US-Handelsministerium hatte nämlich ebenfalls im Februar eine Liste mit Ländern veröffentlicht. Darin hieß es, dass man alle Staaten auf unlautere Handelspraktiken hin „überprüfen“ wolle, die entweder ohnehin eine große Wirtschaft oder ein großes Handelsdefizit mit den USA haben, die also mehr in die Vereinigten Staaten exportieren, als sie von dort importieren. Donald Trump denkt, das sei ein Problem. Viele Experten sehen das anders. Auf der Liste mit den zu überprüfenden Staaten fand sich nun aber eben auch die Schweiz wieder.
Kommt das Freihandelsabkommen zwischen Schweiz und USA?
Das Seco veröffentlichte ein Statement zu dieser Ankündigung aus dem US-Handelsministerium, in dem es heißt: „Sowohl die USA als auch die Schweiz schätzen wirtschaftliche Freiheit, Unternehmertum, vernünftige Regulierung und eine marktbasierte Wirtschaftspolitik. Unsere Geschäftsgemeinschaften sind eng miteinander verbunden. Wir regulieren nicht übermässig. Wir haben keine diskriminierenden Steuern oder Subventionen.“ Die Schweiz sorge außerdem bereits für mehr als 400 000 Arbeitsplätze in den USA und zahle mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 131 000 US-Dollar sehr hohe Löhne. Unklar, ob die Trump-Administration sich davon beeindrucken lässt. Seco-Direktorin Helene Budlinger Artieda schrieb auf X es hätten „produktive Diskussionen“ stattgefunden. Manche träumen schon von einem Freihandelsabkommen zwischen Schweiz und USA. Andere weisen darauf hin, dass US-Sanktionen gegen die EU auch die Schweizer Wirtschaft hart treffen würden, zum Beispiel Autozulieferer.
Manche Unternehmer wie Nick Hayek, Chef der Swatch-Group, wollen das Problem gleich selbst in die Hand nehmen. Er hat Trump in die Schweiz eingeladen, vor allem, um ihn vom dualen Bildungssystem dort zu überzeugen, wie er bei einer Pressekonferenz sagte. Auch unklar, ob Trump sich davon beeindrucken lassen würde.
Rahul Sagal, der Vorsitzende der Schweizer-Amerikanischen Handelskammer versuchte in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Le Temps die Wogen über dem Atlantik zu glätten und sagte über die Drohungen aus Washington: „Von Vergeltungsmaßnahmen war die Schweiz bislang nicht betroffen. Wir tun alles, um das zu vermeiden.“ Das klingt gar nicht so beruhigend, wie es wahrscheinlich gemeint war.