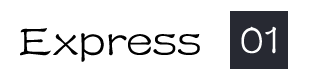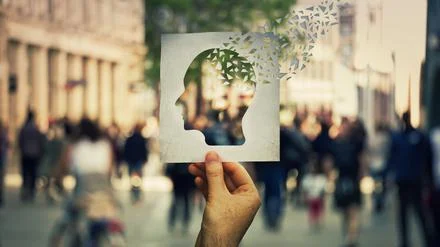Ein Minister, der im Parlament um Entschuldigung bittet, das kommt nicht alle Tage vor. So fällt sie denn auch ein wenig wohlfeil aus, als der Bayerische Kulturminister Markus Blume (CSU) im Landtag eingesteht, dass es beim Thema NS-Raubkunst bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen „Raum für Fehlinterpretationen“ gegeben habe.
Er selbst habe immer geglaubt, „dass wir bei den Staatsgemäldesammlungen weiter wären“. Der Schwarze Peter liegt damit bei den Museen, nicht dem eigenen Ministerium. Ein aufrichtiges Schuldeingeständnis klingt anders. Und doch hat der Skandal um die geleakte Liste mit 200 Werken, die unter Raubkunst-Verdacht stehen, auch ihr Gutes.
Die Opfer können sich darauf verlassen, dass wir alles tun werden, um noch mehr Tempo und maximale Transparenz herzustellen
Markus Blume, bayerischer Kulturminister
Damit die Gemäldesammlungen ihren Aufgaben in der Provenienzforschung fortan schneller nachkommen, soll eine „Taskforce“ mit zwei zusätzlichen Forschungsstellen und einem Etat von einer Million Euro eingerichtet werden. „Die Opfer können sich darauf verlassen, dass wir alles tun werden, um noch mehr Tempo und maximale Transparenz herzustellen“, versprach Blume.
Verwirrung über die rote Ampelschaltung
Die Ankündigung verband der Minister allerdings mit einer Attacke gegen die „Süddeutsche Zeitung“, deren Bericht über die zugespielte Liste die Museen in Misskredit gebracht habe. Die Interpretation, dass „Rot“ gleichbedeutend für Raubkunst stehe und den Erben die Informationen vorenthalten worden sei, sei falsch, betonte der Minister.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
„In Deutschland entscheidet nicht die SZ, was Raubkunst ist“, formulierte er scharf und machte die Zeitung für den erlittenen Reputationsschaden verantwortlich.
Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen kündigten bereits am Vortag presserechtliche Schritte gegen die SZ an und verwiesen darauf, durchaus Restitutionen vorgenommen zu haben; allein in den letzten vier Jahren waren es fünf, die Übergabe von vier weiteren steht an.
Die Irritation über verheimlichte oder doch nur vermutete Raubkunst war dadurch entstanden, weil die Bayern beim internen Arbeitspapier „MuseumPlus“ anders als sonst üblich bereits bei Verdachtsmomenten die Ampel auf Rot schalten. Das soll sich ändern.
Blume sicherte zu, dass sich die Klassifizierung künftig nach den Standards des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste richtet und sämtliche Ergebnisse der Provenienzforschung veröffentlicht werden. Und: Bis 2026 wird es für alle noch nicht geprüften Werke einen Zeitplan zwecks systematischer Einschätzung geben.
Der Landtag hat die Zeichen der Zeit erkannt, allerdings brauchten die Abgeordneten dafür offenbar den Skandal, auch wenn er nicht seine volle Wucht entfaltete. Mit großer Einmütigkeit stimmten sämtliche Fraktionen auf der Plenarsitzung den beiden Dringlichkeitsanträgen von CSU und Sozialdemokraten sowie Freien Wählern zu, die schon am Vortag auf einer Ausschusssitzung verabschiedet worden waren.
Bis zum Sommer will das „Hohe Haus“ über die Fortschritte unterrichtet sein, weitere Gelder für die Provenienzforschung stehen bereits in Aussicht.
Das Krisenmanagement funktioniert offensichtlich in Bayern, doch bleibt ein Verdacht zurück, so schnell wie plötzlich Mittel und neue Strukturen gefunden wurden, um jahrelange Defizite auszugleichen. Schon tut sich die nächste Lücke auf: die Einrichtung eines schlichtenden Organs, an das sich die Parteien – die Nachfahren und Museen – bei Uneinigkeit über eine Rückgabe wenden können.

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München
Die bisher tätige Beratende Kommission ist bereits abgeschafft, die von Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf der Grundlage eines neuen Gesetzes vorgesehenen Schiedsgerichte müssen erst noch eingerichtet werden. Die Betonung von Minister Blume, dass mit ihnen endlich Rechtssicherheit für die Erben herbeigeführt werde, lässt nicht unbedingt Gutes ahnen.
Im Zweifel für die Nachfahren galt bisher bei strittigen Fällen. Aus diesem Grund dürfte sich das Ministerium einer Verhandlung über das Picasso-Bildnis „Madame Soler“ und die einstigen Werke des Kunsthändlers Alfred Flechtheim bisher verweigert haben. Die künftigen Schiedsgerichte werden strenger urteilen, steht zu befürchten.
Die Grünen-Abgeordnete Sanne Kurz hatte in ihrem Redebeitrag noch vehement „Schluss mit bürokratischen Hürden“ gefordert, statt weiter auf die Schiedsgerichte zu verweisen.
Die kritischen Fälle in den Staatsgemäldesammlungen dürften in Zukunft zumindest sehr viel genauer beobachtet werden.